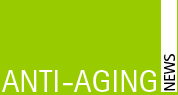Ein nachlassender Geruchssinn kann eines der frühesten Anzeichen für Alzheimer sein, noch bevor sich kognitive Beeinträchtigungen zeigen. Forschungen von Wissenschaftlern des DZNE und der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) werfen ein neues Licht auf dieses Phänomen und weisen auf eine wichtige Rolle der Immunantwort des Gehirns hin, die offenbar die für die Geruchswahrnehmung entscheidenden Nervenfasern fatal angreift. Die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichte Studie basiert auf Beobachtungen an Mäusen und Menschen, darunter Analysen von Hirngewebe und sogenannte PET-Scans. Diese Erkenntnisse könnten dazu beitragen, Wege für eine frühzeitige Diagnose und damit auch für eine frühzeitige Behandlung zu finden.
Wie der Geruchssinn mit Alzheimer zusammenhängt
Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass diese Geruchsfunktionsstörungen entstehen, weil Immunzellen des Gehirns, sogenannte „Mikroglia“, Verbindungen zwischen zwei Hirnregionen, nämlich dem Riechkolben und dem Locus coeruleus, entfernen. Der Riechkolben, der sich im Vorderhirn befindet, analysiert sensorische Informationen von den Geruchsrezeptoren der Nase. Der Locus coeruleus, eine Region des Hirnstamms, beeinflusst diese Verarbeitung durch lange Nervenfasern, die von Neuronen im Locus coeruleus ausgehen und bis zum Riechkolben reichen. „Der Locus coeruleus reguliert eine Vielzahl physiologischer Mechanismen.
Dazu gehören beispielsweise die Durchblutung des Gehirns, Schlaf-Wach-Zyklen und die sensorische Verarbeitung. Letzteres gilt insbesondere auch für den Geruchssinn“, sagt Dr. Lars Paeger, Wissenschaftler am DZNE und der LMU. „Unsere Studie legt nahe, dass es im frühen Stadium der Alzheimer-Krankheit zu Veränderungen in den Nervenfasern kommt, die den Locus coeruleus mit dem Riechkolben verbinden. Diese Veränderungen signalisieren den Mikroglia, dass die betroffenen Fasern defekt oder überflüssig sind. Infolgedessen bauen die Mikroglia sie ab.“
Veränderungen in der Membran
Konkret fand das Team um Dr. Lars Paeger und Prof. Dr. Jochen Herms, Mitautor der aktuellen Veröffentlichung, Hinweise auf Veränderungen in der Zusammensetzung der Membranen der betroffenen Nervenfasern: Phosphatidylserin, eine Fettsäure, die normalerweise im Inneren der Membran einer Nervenzelle vorkommt, war nach außen gewandert. „Das Vorhandensein von Phosphatidylserin an der Außenseite der Zellmembran ist bekanntlich ein „Fress-mich”-Signal für Mikroglia. Im Riechkolben ist dies in der Regel mit einem Prozess verbunden, der als synaptisches Pruning bezeichnet wird und dazu dient, unnötige oder dysfunktionale neuronale Verbindungen zu entfernen“, erklärt Paeger. „In unserem Fall gehen wir davon aus, dass die Veränderung der Membranzusammensetzung durch eine Hyperaktivität der betroffenen Neuronen aufgrund der Alzheimer-Krankheit ausgelöst wird. Das heißt, diese Neuronen zeigen eine abnormale Feuerungsaktivität.“
Die Erkenntnisse von Paeger und seinen Kollegen basieren auf einer Vielzahl von Beobachtungen. Dazu gehören Studien an Mäusen mit Merkmalen der Alzheimer-Krankheit, die Analyse von Gehirnproben verstorbener Alzheimer-Patienten und Positronen-Emissions-Tomographie-Untersuchungen (PET) des Gehirns von Personen mit Alzheimer oder leichter kognitiver Beeinträchtigung. „Geruchsprobleme bei der Alzheimer-Krankheit und Schäden an den damit verbundenen Nerven werden schon seit einiger Zeit diskutiert. Die Ursachen waren jedoch bislang unklar. Nun deuten unsere Ergebnisse auf einen immunologischen Mechanismus als Ursache für solche Funktionsstörungen hin – und insbesondere darauf, dass solche Ereignisse bereits in frühen Stadien der Alzheimer-Krankheit auftreten“, sagt Joachim Herms, Forschungsgruppenleiter am DZNE und der LMU sowie Mitglied des Münchner Exzellenzclusters „SyNergy“.
Perspektiven für eine frühzeitige Alzheimer-Diagnose
Seit kurzem stehen sogenannte Amyloid-beta-Antikörper für die Behandlung von Alzheimer zur Verfügung. Damit diese neuartige Therapie wirksam ist, muss sie in einem frühen Stadium der Erkrankung angewendet werden, und genau hier könnte die aktuelle Forschung von Bedeutung sein. Diese Ergebnisse könnten laut den Forschern den Weg für die frühzeitige Identifizierung von Patienten ebnen, bei denen das Risiko besteht, an Alzheimer zu erkranken, sodass sie sich umfassenden Tests unterziehen können, um die Diagnose zu bestätigen, bevor kognitive Probleme auftreten. Dies würde eine frühzeitigere Intervention mit Amyloid-beta-Antikörpern ermöglichen und die Wahrscheinlichkeit einer positiven Reaktion erhöhen.